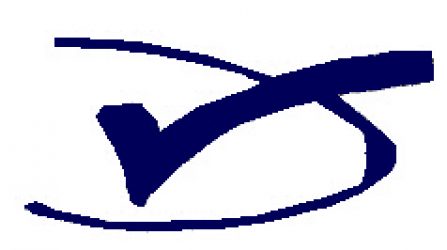Danke für alles Gute, was mir hier passiert und schon passiert ist – für die Segensvoten, die Ansprache, überhaupt der Gottesdienst. Danke für so viel Gutes!
Predigt – Matthias-Claudius-Zentrum
Einführungsgottesdienst
Freut euch, weil ihr Hoffnung habt (Römer 12,12)
Sie trauen und muten es mir wohl zu: dass ich es gut mache und dass ich gut bin.
II.
Wie kann man etwas Gutes tun? Das fragt sich der, der neu ist und seine Adressaten noch gar nicht kennt, der aber von Anfang an kräftig um Unterstützung bittet und allerhand konkrete Ratschläge hat.
Jetzt rede ich von Paulus, der tatsächlich an eine ihm noch unbekannte römische Gemeinde schreibt. Er möchte für seine Spanienreise Kollektenmittel eintreiben. Und Paulus redet selbstverständlich und wortwörtlich vom Guten : „Hasst das Böse, hängt dem Guten an!“ (Lu84)
Und dann breitet er eine Art Tugendkatalog für das Gute aus – wir haben das vorhin der Lesung gehört:
Teilt, was ihr habt!
Seid jederzeit gastfreundlich!
Zieht alle an einem Strang
Lebt mit allen Menschen in Frieden!
Das ist gut. Und gut gemeint, auch für uns heute: Wir erleben in diesen Tagen – nicht nur in unseren Diakonischen Werken und unseren Kirchengemeinden –, wie die Menschen teilen, für Flüchtlinge spenden und ihre Zeit und Hilfe anbieten. Wir merken, dass die Wohlfahrtsverbände an einem Strang ziehen. Viele Deutsche werben für Integration, damit wir tatsächlich in Frieden miteinander leben.
Wie tue ich etwas Gutes?!
Im Zusammenhang mit dem Diakonischen und mit dem konkreten Blick auf die Flüchtlingsnot scheint das eine merkwürdige Frage. Man tut es einfach…
III.
„Es ist eine Zumutung sondergleichen, die an jeden, der das Problem einer christlichen Ethik auch nur zu Gesicht bekommen will, gestellt werden muss: die Zumutung nämlich, die beiden Fragen […], „wie werde ich gut“ und „wie tue ich etwas Gutes“, von vorneherein als der Sache unangemessen aufzugeben.“
So beginnt die „Ethik“ des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffers, vor 70 Jahren von den Nazis ermordet. An der unvollendeten Ethik, seinem Hauptwerk, schrieb er viele Jahre, auch in der Haft.
Schon ganz am Anfang lehnt Bonhoeffer jegliche moralische Beschreibung des Guten ab. Er verbietet sogar aus christlicher Sicht die Frage danach, wie ich gut werde und wie ich etwas Gutes tue.
Denn zu seiner Zeit, zur Zeit des Nationalsozialismus, versagten für Bonhoeffer alle herkömmlichen ethischen Leitlinien: seien es diejenigen, die an der Vernunft, dem Gewissen, an der Pflicht, an der persönlichen Tugendhaftigkeit orientiert sin, oder die, die ohne jede Norm auskommen wollen.
Bloß moralisch kann man sich dem Guten nicht nähern. Das Gute kann schnell Hintergedanken haben oder Ideologien oder Egoismen, so Bonhoeffer.
Und heute? – In der aktuellen Ausgabe der „Zeit“ schreibt die Journalistin Marion Detjen selbstkritisch über die Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen:
„Wir alle wollen unbedingt helfen, sind wie besessen davon, zu helfen. Es ist fast wie eine Erlösung. Es tut gut, gut sein zu dürfen. Manchmal denke ich, dass diese Krise für uns auch eine Midlife-Krise ist: Wir sind eine alternde Gesellschaft, die sich eingerichtet und für ihr Nötigstes gesorgt hat, sich aber in ihrem Egoismus langweilt und eigentlich auch weiß, dass in unserer Welt ganz anders angepackt werden müsste, um die überwältigenden Probleme zu lösen. Da kommt es wie gerufen, wenn man in die Erstaufnahme fahren und eine obdachlose Familie für ein paar Nächte nach Hause mitnehmen kann, um wieder zu fühlen, was menschliches Miteinander eigentlich bedeutet, wenn man die Verantwortung nicht auf Institutionen abschieben kann.“ (Marion Detjen, Die Zeit, online vom 7.9.15)
Harte Worte, die für mich das Engagement für Flüchtlinge nicht schmälern soll, auch alles diakonische Tun nicht disqualifizieren soll. Aber Worte, die nach dem Fundament unseres Tuns fragen.
Für Bonhoeffer ist die Lösung klar: Es geht für Christinnen und Christen nicht darum, nach dem Guten zu fragen, sondern danach zu fragen, was der Wille Gottes ist.
Was das Gute ist, kann nicht abseits von der Wirklichkeit Gottes geklärt werden und nicht abseits von der Frage, was Gott für diese Welt und von uns will. Ohne Gott lässt sich für Bonhoeffer nicht über Ethik reden. Ich könnte das weiterdenken und sagen: Ohne die Wirklichkeit Gottes können wir uns nicht der Frage nähern, warum wir diakonisch tätig werden.
Was sieht Gott für diese Welt vor?
Welches Bild vom Menschen hat er?
Das sind zwei entscheidende Fragen.
Die Frage nach dem Willen Gottes zu stellen, ist alles andere als Weltflucht: Bonhoeffers Theologie ist durch und durch diesseitig. Er denkt konsequent von Jesus Christus her: In ihm wurde Gott Mensch. Es gibt Christus nicht ohne Welt. Aber auch umgekehrt: Es gibt die Welt nicht ohne Christus.
Beide Wirklichkeiten sind miteinander verwoben: die Wirklichkeit Gottes und die Wirklichkeit der Welt. Christus ist die Klammer. Das macht ihn auch so diakonisch: dass er mitten in dieser Welt dient – und damit in der Not und dem Leid der Menschen gegenwärtig ist – , aber genauso dass Jesus innerlich frei ist von dieser Welt ist und in ihr nicht aufgeht, sondern diese Welt am Ende überwunden hat.
Ich wünschte mir, dass wir Jesus, den Christus, neu entdeckten; er ist oft so merkwürdig weggerutscht in Predigten, dem Kirchlichen Unterricht und unserer Frömmigkeit. Dabei wissen wir von Gott nichts außer durch ihn.
III.
Auch für Paulus ist Jesus, der Christus, das Fundament für alles Gute, zu dem er die Römer ermutigen will:
„Christus ist unsere Hoffnung“ schreibt er im 1Kor. Im Röm hat das einen befreienden, ja erlösenden Zungenschlag: „Freut euch, weil ihr Hoffnung habt!“
Freut euch, dass ihr in Euerm Tun mit Christus ganz in dieser Welt verhaftet seid, dass Ihr aber genauso mit Euerm Tun auf den neuen Himmel und die neue Erde hinweist, die Gott mit der Auferweckung Jesu versprochen hat. Unser Tun kann und darf also nie abgehoben sein von der Not, sondern zielt auf die Überwindung von Not.
„Hoffnung“ weist aber grundsätzlich über mich hinaus. Hoffnung gibt einen größeren Referenzrahmen für all mein Tun.
Ich möchte das konkret machen:
Eine Ehrenamtliche berichtete von einer syrischen Familie in einem der Aufnahmelager. Der Vater – kriegsverletzt durch eine Schusswunde. Die Mutter erlitt mit Zwillingen eine Frühgeburt. Es überlebte ein Kind, von Geburt an behindert. – Bei aller fachlichen Hilfe – was wäre, wenn diese Familie und ihre Helfer nicht ihre Hoffnung obenan stellen würde, dass ihr Leben in Deutschland nun eine Zukunft hat über das Sichtbare hinaus?!
Oder ein anderes Beispiel: Wir sind hier in einem Haus, in dem Menschen in Würde alt werden können. Die Bewohner wissen aber auch, dass sie – trotz guter Pflege – mit der Zeit schwächer und pflegebedürftiger werden und sich dem Sterben nähern. – Wie „gut“ ist diakonisches Handeln hier, wenn Bewohner und Pflegerinnen nicht auch die Hoffnung formulierte über das Sichtbare hinaus?!
Ich hörte die Geschichte eines Bewohner, längst über 90 Jahre alt, wie er stolz davon erzählte, dass er sich einen neuen Mercedes bestellt hätte. „Einen Diesel!“ – Warum denn einen Diesel?“ fragte jemand zurück. – „Junger Mann, ist doch klar“, soll er geantwortet haben: „Ein Dieselmotor hält doch länger!“
Freut Euch, weil ihr Hoffnung habt! Oder Lu84: Seid fröhlich in Hoffnung!
Ich habe schon mehrere leitende Mitarbeiter aus unseren Werkstätten kennen gelernt, die aus der freien Wirtschaft in die Diakonie gewechselt sind: Weil Gewinnmaximierung auf Dauer kein erfüllendes Ziel war, sondern die Beschäftigung mit dem Menschen und wie man ihn in Arbeit bringt.
Reden wir über unsere Hoffnung! Das ist in dieser so rationalen und gegenwartsbezogenen Zeit so unendlich wichtig. Es gibt keine großen Entwürfe mehr, aber wir spüren, dass sich Vieles verändern muss und die Zeit drängt.
Vielleicht ist „Hoffnung“ das große Wort der Diakonie im 21. Jahrhundert, so wie es die Worte „Barmherzigkeit“ im 19. Jahrhundert war und „Gerechtigkeit“ im 20. Jahrhundert.
Freut Euch, weil ihr Hoffnung habt!
Ich habe schon die Erwartung an mich als Diakoniepfarrer gehört, dass ich sonntags so predigen soll, wie ich unter der Woche auch handele. Es ginge um meine Glaubwürdigkeit. Ja gut.
Aber was ist mit der Glaubwürdigkeit Gottes? Auf der Kanzel dürfen, ja sollen wir mehr sagen, als wir verantworten können, weil wir mit Gott rechnen dürfen und damit sein Kommen vertreten dürfen, was wir eben nicht verbeiführen können. So ist es auch mit jedem Handschlag im diakonischen Zusammenhang: Er kann auf mehr deuten: auf Hoffnung.
IV.
Was hoffe ich? – Tatsächlich rührt mich der Satz des Paulus an: „Eure Liebe sei ohne Falsch!“ „Eure Liebe sei ohne Hintergedanken!“ (BigS)
Ich hoffe und glaube auch, dass wir nicht helfen, um uns selber besser zu fühlen oder vorrangig weil es einen Kostenträger gibt. Sondern weil wir mit unserer Haltung dem Nächsten gegenüber unsere Hoffnung für diesen Menschen ausdrücken.
In den Umweltwerkstätten, wo wir uns oft um Langzeitarbeitslose kümmern, sagte mir ein Dienststellenleiter: „Bei jedem habe ich immer wieder neu die Hoffnung, dass dieser Menschen Fähigkeiten hat, die gebraucht werden.“
Welch ein Hoffnungssatz! Er ist mir nachgegangen!
Ich selber habe es so ähnlich bei meiner Ordination versprochen: „Gib keinen auf“ – so steht im Ordinationsversprechen von Pfarrerinnen und Pfarrer.
So ein Hoffnungssatz ist mir- mit Paulus und mit Bonhoeffer gesprochen – tatsächlicher eine große Freude und wichtiger als die Frage, ob ich „gut“ bin oder ob ich „das Gute“ tue.