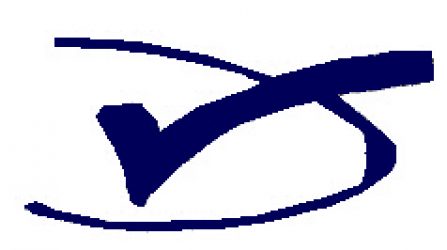„Jesus sah die Stadt Jerusalem und weinte über sie und sprach: „Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient!“ (Lk 19,41-48, hier: 41f.)
1. So. n. Trinitatis Lutherkirche Altena / Ref. Kirche Wiblingwerde Israelesonntag, #Lk 19,41-48
I.
Das ist der Kern des Evangeliums für den heutigen Sonntag, das wir vorhin vom Altar gehört haben. Jerusalem steht im Zentrum dieses Gottesdienstes. Warum dies? Was sucht Jerusalem im christlichen Gottesdienst? Man kann auch umgekehrt fragen: Was suchen Christen in Jerusalem? Sie suchen den Ort Jesu, den Ort seiner Kreuzigung und Auferweckung. Sie suchen — so ist zu hoffen — die Geschichte des Volkes, dem Jesus entstammte, die Geschichte Israels. Sie vergegenwärtigen sich, dass der Bund Gottes mit diesem Volk nicht gekündigt ist.
Deshalb feiern wir den Israel-Sonntag als einen wichtigen Sonntag im christlichen Kalender. Gott nimmt seine Verheißungen nicht zurück. Er bleibt dem Volk Israel treu. Spät erst haben wir erkannt, dass dies zum christlichen Bekenntnis gehört: Gottes Treue zu seinem Volk Israel. Auf schmähliche Weise haben wir als Christen uns gegen diese Treue Gottes gegenüber seinem Volk vergangen. Auch in der christlichen Predigt geschah das. Deshalb begehen wir einen Israel-Sonntag. Er dient der Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Deshalb steht Jerusalem heute im Zentrum unseres Gottesdienstes. Und mit ihm Jesus, der Jude, der über Jerusalem weint.
II.
Alle jubeln, einer weint. Gerade ist Jesus nach Jerusalem eingezogen, unter dem Jubel der Massen. „Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ So hatten die Menschen gerufen, ihre Kleider hatten sie ausgebreitet, mit Palmzweigen ihm zugewinkt. Aber der so Gefeierte schaut auf die Stadt Jerusalem, die Stadt des Friedens, den Zion Gottes und weint.
Am Fuße des Ölbergs, im heutigen Jerusalem, liegt eine Kapelle, die heißt: „Dominus flevit“, zu deutsch: „Der Herr weinte“.
Als Christen erinnern wir uns daran, dass Jesus auf die Stadt seines Volkes sah, mit jüdischen Augen, jüdischem Glauben. Und: Dass er sich nicht über sie. Er weinte über sie. Auch heute kann keiner aufrichtig nach Jerusalem gehen, ohne zu weinen, wenn man diese geteilte Stadt und ihr Schicksal verfolgt.
III.
Dass Jesus weint, passt nicht ins gewohnte Bild. Schon in alter Zeit galt der weinende Jesus als Ärgernis. Man konnte nichts mit ihm anfangen – bis dahin, dass rechtgläubige Christen beabsichtigten, den Satz über das Weinen Jesu aus dem Neuen Testament zu streichen.
Ein heulender Heiland, das ging über ihre Vorstellungskraft!
Mir macht ein weinender Jesus keine Angst. Er befreit. Vor ihm braucht man sich nicht zu fürchten. Ihn braucht man nicht aus dem Evangelium zu streichen. Er gehört in seine Mitte.
Nah an Jesus sind wird, wenn wir ihm zutrauen, dass er um Jerusalem trauert und um des Friedens willen weint. Die Tränen, die er über Jerusalem vergießt, offenbaren uns das Geheimnis seiner Person. In seinen Tränen zeigt sich das Herz des barmherzigen Gottes. Es ist ein teilnehmendes Herz, ganz menschlich können wir sagen: ein Herz voll Sympathie. Die Tränen in seinem Angesicht zeigen uns, dass Jesus mit unserer Welt mit leidet, dass er den Frieden dieser Welt will, ganz besonders den Frieden für Jerusalem. Es sind Tränen des Mitleids aus Liebe zu und Solidarität mit dem von Gott erwählten Volk Israel.
Alle jubeln, einer weint.
Aber passt das Weinen zum Messias? Können wir unser Leben an einem orientieren, der weint?
In einer Diskussion junger Leute mit einem Politiker fragte einer der Jugendlichen den Minister unvermittelt: „Können Sie eigentlich noch weinen?“ Rückfrage des Ministers: „Warum wollen Sie das wissen?“ Darauf der junge Mann: „Ich möchte nicht von jemandem regiert werden, der nicht mehr weinen kann.“
Jesus verlangt nicht, dass man alles „ganz frei von Emotionen betrachten müsse“. Er lässt Emotionen zu, nein, er gibt ihr Raum: der Emotion der Teilnahme, in der sich das Herz Gottes zeigt.
IV.
Diese Empfindung Jesu war dem Evangelisten Lukas so wichtig, weil Lukas die Geschichte kannte. Als er im Jahr 80 sein Evangelium schreibt, wusste er, was bei Jesu Einzug in Jerusalem erst noch bevorstand. die Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer im Jahre 70. Das war nicht die erste Zerstörung des Tempels, sondern die zweite. Beide Zerstörungen fanden im August statt. Beim ersten Mal waren es die Babylonier, beim zweiten Mal im Jahr 70 die Römer. 640 Jahre lagen zwischen diesen beiden Zerstörungen. Nach der ersten Zerstörung wurde der Tempel wieder aufgebaut, damit er wieder die „Wohnung des Namens Gottes“ würde.
Der zwölfjährige Jesus geht in den Tempel, um dort zu lehren und von Gott zu reden.
Als er das zweite Mal wiederkommt, da ist kein Raum mehr für das Gespräch mit Gott und in der Runde andere Menschen von Gott. Dafür muss erst wieder Raum geschaffen werden. Deshalb treibt Jesus die Geldwechsler und die Opfertierverkäufer aus dem Tempel.
Es gehört zur Auslegungsgeschichte dieses Textes und zum christlichen Antijudaismus über Jahrhunderte, dass man immer wieder die Geldwechsler im Tempel mit der angeblichen Habsucht und den „krummen Geschäften“ der Juden identifiziert hat. Das hat erst den Holocaust möglich gemacht – und uns genötigt, wenigstens einmal im Jahr an einem Israelsonntag über hoffentlich wieder verändertes Verhältnis von Christe und Juden nachzudenken.
Gegen alle Stereotypen: Die Geldwechsel tun in Wirklichkeit nichts Schlimmes. Sie bieten gutes israelitisches Geld für das schlechte römische. sie tauschen Geld, das die Bevölkerung für Opfertiere im Tempel ausgeben kann.
Mein Haus soll ein Bethaus sein – Jesus geht es um nichts anderes als um das Reich Gottes und die Entscheidung zum gnädigen Gott. Er will im Tempel lehren, über Gott sprechen, beten. Er möchte, dass eine persönliche Gottesbeziehung besteht – Gott liebevoll „Abba“ genannt werden darf, dass der Glaube nicht hinter formalen Korrektheiten und Vorschriften versteckt werden darf, wie es zu seiner Zeit einige seiner Glaubensgenossen tun.
Das macht freilich aus einem Jesus, der weint, einen, der wütet. Der nicht nur Tränen der Enttäuschung vergisst, sondern auch Tränen der Wut, des Protestes, der Parteinahme für Gott. Warum erkennt ihr nicht, was zum Frieden dient? Warum verstellt ihr euch den Blick auf Gott?
V.
Alle weinen, einer aber lacht. Als vier jüdische Rabbiner, darunter Rabbi Akiba, sich einmal dem zerstörten Tempel in Jerusalem näherten, kam ein Fuchs aus den Trümmern hervor. Da spürten sie, wie weit es gekommen war, und begannen zu weinen — bis auf einen, bis auf Rabbi Akiba. Rabbi Akiba lachte, zum Erstaunen, nein zum Erschrecken der andern. Er aber hielt ihnen entgegen: Wenn Gott seine Drohung wahr gemacht habe, Zion werde wie ein Feld umgepflügt, wie sollte er da nicht die Verheißung wahrmachen, die sich beim Propheten Sacharja findet? Denn dort heißt es: „Es werden noch Greise und Greisinnen in Jerusalem wohnen.“
Vom zweimal zerstörten Tempel ist nur ein Stück übrig geblieben, das heute die Klagemauer ist. Der Tempelberg selbst ist muslimisch. An der Klagemauer verrichten gläubige Juden ihr Gebet, mit einer Ausdauer, die auch gebetsgeübte Christen erstaunt und die bei Menschen, die das Beten verlernt haben, nur noch Unverständnis auslöst. Die rhythmischen Bewegung des Gebets, das leise Murmeln ihrer Worte, das Gleichmaß der Klage über die Jahrtausende – in keiner anderen Weltreligion gibt es ein vergleichbares Beispiel für die religiöse Bedeutung, ja Hochschätzung der Klage wie in Jerusalem. In keiner anderen Religion nimmt der leidende Gottesknecht so vielgestaltige Formen.
„Wenn doch auch du erkenntest, was dem Frieden dient!“ Als Christen in Deutschland sind wir nicht gut geeignet, Ratschläge zum Frieden zu geben. Noch immer werden wir danach gefragt, wie ernst uns die Absage an den Antisemitismus ist und wie endgültig wir das Existenzrecht des Staates Israel anerkennen. Wieder und wieder sind wir durch die Anschläge im Gazastreifen aufgewühlt. Aber wir sollten uns davor hüten, zu den Rechthabern zu zählen. Stattdessen sollten wir uns an den weinenden Jesus halten. Wer weint, hat nicht Recht, sondern Kummer.
„Mein Jesus hat geweint um seine Stadt, ach, auch gewiss um mich hat er geweinet.“ Annette von Droste-Hülshoff hat so gedichtet. Man nimmt das Weinen Jesu seiner Stadt Jerusalem nicht weg, wenn man bekennt: Es gilt auch uns. Er bleibt ein Sohn seines Volkes und ist doch der Messias der Völker. Miteinander sind wir verbunden, Juden wie Christen, durch die Verantwortung für Versöhnung und Frieden. In der Hoffnung nach Versöhnung und Frieden.
Und in der Einsicht: Bei jedem einzelnen fängt der Frieden an. Denn uns öffnet Gott sein Herz. In dem Jesus, der weint und wütet. Amen.