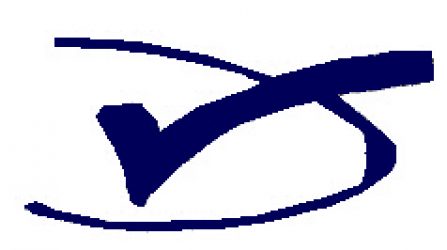Impuls auf der Studientagung der ACK NRW, 22. März 2017, Wuppertal
Entscheidend fürs Thema sind die beiden Zusätze: zum einen: „für die ganze Gesellschaft“. Man könnte fragten, was ist die „ganze“ Gesellschaft mit Blick auf Europa. Regierungen in Ungarn, Polen und der Slowakei tun sich mehr als schwer. In den osteuropäischen Zivilgesellschaften gibt es aber wohl weit mehr Potential und Bereitschaft, sich um Flüchtlinge zu kümmern, als die jeweiligen Regierungen ausstrahlen.
Eine humanitäre Flüchtlingspolitik in ganz Europa bedeutet für mich weiterhin, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört und Fluchtursachen bekämpft würden, dass ein europäisches Einwanderungsgesetz formuliert und eine EU-weite Lösung für eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge ermöglicht wird.
Mit Blick auf Deutschland lohnt die Frage, was „ganze Gesellschaft“ bedeutet: Wer ist eigentlich das „Wir“ im „Wir schaffen das!“-Mantra der Kanzlerin?
Es ist ja richtig, dass wegen der Flüchtlinge kein Cent weniger in KiTas, Tagesaufenthalte für Obdachlose oder Arbeitslosenförderung fließt. Aber ist es auch richtig, dass sich mit der erhöhten Anzahl von Menschen, die sich um einen Kindergartenplatz bewerben oder Arbeit suchen oder soziale Unterstützung brauchen, auch die Mittel erhöhen müssten. Sonst schultern am Ende die in unserer Gesellschaft Benachteiligten überproportional stark die Flüchtlingsintegration. Oder kommunale Finanzen kommen durch höhere Regelfinanzierungen weiter aus dem Lot.
- Die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände
Zum anderen ist der entscheidende Aspekt der Themenstellung „die Rolle der Kirche“: Man kann dies nicht oft genug betonen – und es soll hier den Schwerpunkt bilden: Die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände sind Teil dieser humanitären und gesamtgesellschaftlichen Herausforderung.
Die Rolle ist zunächst gesellschaftlich zugewiesen: Wie selbstverständlich haben die Bürger im Spätsommer 2015 Flüchtlingshilfe aus Kirchengemeinden und Verbänden heraus gestaltet. Die Kirchen sind in Anspruch genommen, weil Menschen es uns zugetraut haben, dass wir helfen können und helfen werden. Ich sage: Wir hätten gar nicht anders gekonnt, und wir sind den Erwartungen an vielen Stellen gerecht geworden, so dass wir uns über uns selbst freuen können. Viele Gemeinden, auch die Verbände, haben eine ordentliche Vitalisierung erlebt!
Wir beklagen an vielen Stellen das Schwinden von Gemeinschaftsformen (klassische Gemeindearbeit, gewöhnlicher Gottesdienstbesuch). Kirchliche Orte werden – zumeist aus finanziellen Gründen – aufgegeben. Es kreisen – vor allem im evangelischen Bereich – harte Beschreibungen von der Selbstbanalisierung und Selbst-Säkularisierung (Heidelberger Theologe Michael Welker). Wir reden allgemein von der Vertrauenskrise der Kirchen (Münchener Theologieprofessor Friedrich Wilhelm Graf).
Nun sind aber in der Flüchtlingsarbeit Menschen auf uns zugekommen, zu denen wir längst Kontakt verloren haben. Über das Helfen haben Menschen, die die üblichen Gemeindeangebote nicht wahrnehmen, Zugang gefunden zu christlichen Einrichtungen und Gemeinschaften. Unsere Diakonie hat einen unglaublichen Schub an Ehrenamtlichen erlebt, die an vielen Einsatzorten auch mittelfristig geblieben sind.
Studien belegen, dass das Helfen – auch wenn es gar nicht aus einer konfessionellen Zugehörigkeit heraus motiviert war oder ist -, denn noch eine spirituelle, religiöse Dimension hat, die die Helfer auch benennen können.
Kirchen und ihre Verbände als Teil dieser humanitären Herausforderung – das ist die gesellschaftliche Zuschreibung von außen. Aber entspricht sie aber unserer Selbstdefinition und unserem Selbstbild?
Als Diakoniepfarrer eines Kirchenkreises und Geschäftsführer eines Diakonischen Werkes bewege ich mich in zwei Systemen.
Diakonie ist Kirche, aber sie ist als Wohlfahrtsverband gleichzeitig eingebunden in den Sozialstaat und in subsidiäres (nachrangiges) staatliches Hilfehandeln. Diakonie partizipiert wie selbstverständlich am humanitären Auftrag des Gemeinwesen: Die Unantastbarkeit der menschlichen Würde (GG Art. 1), die Gleichheit aller Menschen (GG Art. 3) – das findet sich begrifflich in unserem diakonischen Leitbild.
Aus der Unverletztbarkeit der Wohnung (Art. 13), dem Asylrecht (Art 16a) und erst recht aus dem Art. 20 (Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat) leiten wir Arbeitsfelder ab.
Darauf bezogen existiert in der Diakonie eine theologische Selbstbeschreibung, die aber zwangsläufig eine „übersetzte“ Selbstbeschreibung ist. Sie muss anschlussfähig sein für die humanitären Herausforderungen der ganzen Gesellschaft.
Konkret: Die Diakonie verorten sich theologisch oft in der Erzählung aus Matthäus 25 („Das große Weltgericht“). Der himmlische König scheidet die Völker anhand der Frage, wie sie sich verhalten haben, als sie ihn hungrig, durstig, fremd, krank und gefangen gesehen haben. Zugespitzt heißt es dann in beiderlei Richtungen:
Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir getan/habt ihr mir nicht getan. Gemeint ist hier Christus; und das Heil in Jesus, dem Christus, hängt ab von der Beziehung zum Hilfe suchenden Menschen. Die Christusförmigkeit der Gemeinde (Dietrich Bonhoeffer) erweist sich (oder ist verwehrt) in der Begegnung mit dem Menschen an sich.
Oder noch anders gesagt: Christlichkeit zeigt sich in Humanität – mit allem Risiko, das unser Handeln verwechselbar ist gegenüber dem Handeln aus anders motivierter Humanität; mit aller Unklarkeit, welche Gemeinschafts- oder Organisationsstruktur eine solche Christusförmigkeit mit sich bringt. Darüber sagt Mt 25 nichts.
Der Schweitzer Theologie Arthur Rich hat seine theologische Wirtschaftsethik am Begriff der Humanität entwickelt. „Humanität“ ist für ihn ein anschlussfähiger säkularer Begriff, der sich aber eben auch aus dem Christusereignis heraus füllen lässt. Er kann sagen: „Was spezifisch christlich ist, ist die Erfahrung von Glauben, Hoffnung, Liebe in ihrer Radikalität und Verwurzelung des Christusereignisses“. Und gleichzeitig gilt: „Es gibt keine spezifisch christliche, sondern immer nur eine menschliche Humanität“, zu der auch Humanität aus Glauben, Hoffnung, Liebe als Erfahrungshorizont dazugehört.
Diese Sicht ist für eine Kirchengemeinde weit schwieriger! Sie ist oft die Gemeinschaft der Getauften, die im Gebiet der Gemeinde wohnen. Sie ist sicher durchlässig und offen, hoffentlich eingebunden in das kommunale Gemeinwesen – aber zunächst zählt das formale Mitgliedschaftskriterium.
Hinzu kommt, dass sehr stark nach der „Funktion“ von Religion und die Rolle der Kirche vor Ort als religiöser Dienstleister gefragt wird: Gute Gottesdienste und die Wichtigkeit von Taufen, Trauungen und Bestattungen sind im Fokus, weniger aber die Gemeinwesen- oder Sozialraumorientierung einer Kirchengemeinde und die Frage, welche gemeinsamen Herausforderungen Kirche und andere gesellschaftliche Gruppen gemeinsam in den Blick nehmen können. Kirche und Gemeindehaus sind primär die kirchlichen Orte, nicht die konfessionell durchlässigeren Orte wie die KiTa oder das Altenheim.
Es geht umgekehrt nicht um eine vorschnelle Ethisierung dessen, was Kirche und Diakonie ausmachen. Es geht mehr um eine Ortsanweisung: Wo sehen sich Kirche und Diakonie hingestellt? Sehen wir in der Flüchtlingsarbeit – gegen alle Rückzugstendenzen – eine neue Relevanz, öffentlich Kirche zu sein?
Können wir aus den Erwartungen, die uns die Bürger (nicht nur unsere Mitglieder) in der Flüchtlingsabreit entgegengebracht haben, nochmals unser Selbstbild weiten?
Und vielleicht noch wichtiger: Wie bleiben die Menschen da und die Eindrucke wach, die seit Spätsommer 2015 neu auf uns zugekommen sind?
Ich möchte im letzten Drittel meines Impulses einige gute gemeinsamen Erfahrungen von Gemeinden und Diakonie nennen und danach fragen, was zukünftig zu tun ist:
- Gute Erfahrungen
3.1 Diakonie und Gemeinden haben sich komplementär ergänzt, anstatt – wie meistens in den letzten 150 Jahren – theoretisch über ihre Zuordnung zu debattieren: In jeder der 10 Kommunen des Kreises Recklinghausen sind neue Verbindungen entstanden:
– gemeinsame Mitarbeit an kommunalen Runden Tischen
– Verknüpfung von Sozialraumorientierung der Kirchengemeinden und der Fachlichkeit und Logistik der Diakonie: Erstausstattung von Flüchtlingswohnheimen; Hilfe für traumatisierte/behinderte/kranke Flüchtlinge; Hilfe bei Umzügen (AGH/Arbeitsgelegenheiten aufgelegt);
– Verklammerung durch gemeinsame hauptamtliche Koordinierung Ehrenamtlicher in der Flüchtlingsarbeit (Jens Flachmeier): Fortbildung hauptamtlicher diakonischer MA in kultureller Sensibilisierung und Fortbildung Ehrenamtlicher in rechtlichen Fragen;
– Verknüpfung der Familienbildungsstätte der Diakonie mit Gemeindearbeit / von Kleiderkammern mit Sozialkaufhäusern
– Rückgriff auf vorhandene gemeindliche und diakonische Traditionen aus der Arbeit der 1990er-Jahre (Ev. Gemeindehaus der Kulturen, Marl / Haus der Kulturen in Herten: Migrations- und Flüchtlingsberatung)
3.2 Einbindung der Träger (Subsidiarität)
Es hat in den Kommunen dort gut geklappt, wo Stadtverwaltungen entschieden haben, freie Träger mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Kräften einzubinden. Die Stärke von Diakonie und Caritas sind auch die Ehrenamtlichen in den Gemeinden.
Geheimnis von Subsidiarität: Beispiel Recklinghausen (gemeinsame Unterkunft mit dem gemeindlichen Diakonischen Werk): Mit der Refinanzierung von einem Sozialarbeiter war es möglich, 100 Ehrenamtliche und hohe Spendenmittel zu akquirieren, hauptamtliche Dienste anzudocken (Vermittlung in Arbeit über Sozialkaufhäuser/Beratungsstellen, z.B. Frauenberatungsstellen, psychosoziale Beratungsstelle). Und: Kirchengemeinden als Orte, an denen über Sorgen und Ängste debattiert wurde.
3.3. Die Kirche als Ort der Verständigung und des Austausches gegen Fremdenfeindlichkeit
Allein 2016 registrierte das Bundesinnenministerium 2762 Gewalttaten gegen Geflüchtete und Flüchtlingshelferinnen und -helfern sowie 988 Attacken auf Asylunterkünfte.
In der Christuskirche in Recklinghausen fand in der „heißen Phase“ vor der Errichtung einer Unterkunft in unmittelbarer Nachbarschaft eine große Info-Veranstaltung und später ein Benefizkonzert mit den ersten Bewohnern statt. Die Kirche wurde zum Ort einer angemessenen Auseinandersetzung über die Sorgen und Ängste der Menschen. Das Gemeindeleben wurde eine Art Katalysator für unterschiedliche Meinungen. Es hat zu keinem Zeitpunkt größere Auseinandersetzungen an diesem Standort gegeben.
3.4 Die Wiederentdeckung des demokratischen Mandats der Kirche
Wir helfen Muslimen. Das verändert Kirchengemeinden wie Verbänden in der Notwendigkeit, Erfahrungen mit eigener Diversität zu reflektieren und ihre Sprachfähigkeit in eine religiös plurale Öffentlichkeit neu einzuüben. Ich z.B. war bei unseren unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen in unserem Kinderheim eingeladen, um ihnen in 1 ½ Stunden „das Christentum“ zu erklären – ohne dass jegliche Vorkenntnisse vorauszusetzen waren. Inzwischen haben wir dort den Besuch eines Polizisten und des Landtags begleitet. Wir nehmen darin unserer christlich-kirchliche Verantwortung wahr, für unser demokratisches Gemeinwesen zu stehen. Das berührt auch die Haltung einer positiven Religionsfreiheit gegenüber Andersgläubigen.
4 Was tut Not?
Konkret nach den Herausforderungen der ganzen Gesellschaft und der Kirchen gefragt, sehe ich für das Jahr 2017 – das Jahr der Integration – besonders folgende Herausforderungen:
- Kommunal stark sein
Die Flüchtlingsarbeit ist stark kommunal geprägt durch Hilfestrukturen, Wohnstrukturen und soziale Netzwerke. Die Flüchtlinge dürfen nicht „verschwinden“, wenn sie aus großen Unterkünften ins private Wohnumfeld umziehen. Ehrenamtliche dürfen nicht mit der Begleitung im Wohnumfeld alleingelassen oder überfordert werden. Kirchengemeinden haben große Potentiale, denn ihre Mitglieder leben im Quartier. Aber es bedarf des Ausbaus der kommunalen Infrastruktur (Kindergärten, Schulplätze) und es muss ein ordentlicher Transfer der Hilfe von Flüchtlingsberatungsstellen in die Regelangebote der freien Träger möglich sein (Sprachprobleme, Kapazitäten, Bewilligungen).
4.2 Die Frage nach der Barmherzigkeit und dem Not-Wendenden zieht die Frage von Recht und Gerechtigkeit nach sich.
Aus der Willkommenskultur muss eine Willkommensstruktur werden: Nachdem sich viele Menschen moralisch verpflichtet und mit freiwilliger Solidarität geholfen haben, die erste Not zu beseitigen, geht es nun immer stärker darum, den Flüchtlinge zu ihrem Recht zu verhelfen.
Die Rechtsberatungen der Wohlfahrtsverbände muss dringend ausgebaut werden.
Kirchengemeinden müssen sich vorab (!) sehr rational über ihre Haltung zu möglichen Kirchenasyl-Fällen im Klaren werden.
4.3 Kirchen gegen Populismus
Es gehören knapp 2/3 der Bevölkerung einer christlichen Kirche an. Das immunisiert nicht automatisch gegen Rechtspopulismus. Aber unsere Gemeinden und Verbände sind Orte, in denen eine andere Art der Kommunikation eingeübt werden kann: Orte des freien Wortes, aber auch der klaren Positionierung gegen Menschenfeindlichkeit, Orte der Begegnungen, um Pluralität und Liberalität einzuüben und solidarische Verantwortung.
Wir sollten als Kirche wieder stärker unsere Verantwortung für die Demokratie herausstellen. Wir haben sie erst spät gelernt, aber sie hat mit der Religion gemein, dass es immer um Mäßigung und gegenseitiges Respektieren und gegenseitiges Lernen geht.
Machen wir uns nichts vor: Das Wahlkampfprogramm der AfD ist ein zu aller erst ein Programm gegen die Demokratie, nicht nur gegen Muslime. Und die Grenzen verlaufen auch in unseren Gemeinden!
- Kirchen und ihre Verbände bieten neue Heimat
2017 ist das Jahr der Integration. Integration heißt auch, die neuen Bürger mit ihren Fähigkeiten zu beteiligen (z.B. am Gemeindeleben), sie Impulse setzen zu lassen: Das Gemeindeleben wird sich verändern!
Im Bereich der Verbände wird Integration maßgeblich über Bildung und Arbeit vorangetrieben: In unseren Arbeitsmarktprojekten haben derzeit 20 Flüchtlinge eine Chance, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Der Arbeitsplatz wird schon nach kurzer Zeit zu einem Stück neuer Heimat.
Kirche und Verbände haben hier besondere Möglichkeiten und daher auch besondere Verantwortung. Ich schließe daher mit einem Zitat Hannah Arendts, formuliert angesichts von Millionen Geflüchteter und Vertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg: Das Unglück von Geflüchteten sei nicht „das sie des Lebens, der Freiheit, des Strebens nach Glück, der Gleichheit vor dem Gesetz und der Meinungsfreiheit beraubt sind; ihr Ungleich ist mit keiner der Formeln zu decken, die entworfen wurden, um Probleme innerhalb gegebener Gemeinschaften zu lösen. Ihre Rechtlosigkeit entspringt einzig der Tatsache, dass sie zu keiner irgendwie mehr gearteten Gemeinschaft mehr gehören.“